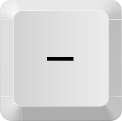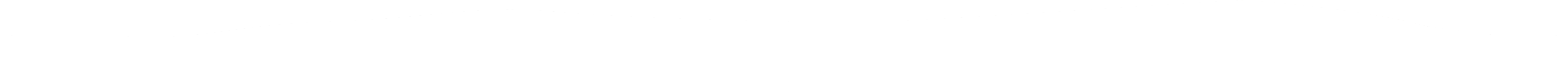
Baudenkmäler
Schloss Sandfort
Schloss Sandfort in Olfen-Vinnum wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt. Die Burg, deren Baugeschichte schwer zu datieren ist, befindet sich im Besitz des Grafen Hagen-Plettenberg.
Bei Haus Sandfort handelt es sich um eine ursprünglich umwallte Wasseranlage mit einem Herrenhaus aus dem 17. oder frühen 18. Jahrhundert und einem Haus mit zwei Rundtürmen auf der Vorburginsel. Das Herrenhaus, das mehrfach verändert wurde, zeichnet sich durch den mit einer Barockhaube versehenen viereckigen Turm aus.
Die Anlage, die Wohnsitz der gräflichen Familie ist, kann von Außen besichtigt werden.



Füchtelner Mühle
Fürstbischof Otto III., Graf von Rietberg (1301-1306), ließ die Füchtelner Mühle als Landesmühle erbauen. Sie gehörte zur Wasserburg Haus Füchteln, die Stammsitz der Ritter von Kukelshem war. Mit der Erschließung des Ruhrgebietes im 19. Jahrhundert wurde die Wassermühle auch als Sägemühle genutzt. Im Zuge des Ausbaues der Stever hat das Wasserwerk Gelsenkirchen das alte Mühlenstaurecht zur Füchtelner Mühle einschließlich der bestehenden Anlagen aufgekauft. 1992 entstand ein Wohnhaus und ein Wasserkraftwerk in den alten Gebäuden.
Das denkmalgeschützte Gebäude wurde inzwischen vom Kreis Coesfeld und der Stadt Olfen erworben. Der Kreis und die Stadt wollen mit dem Erwerb der Wasserkraft- und Stauanlage zukünfitg gemeinsam Verantwortung für die Regulierungsmaßnahmen des Wasserabflusses in der Stever und den Hochwasserschutz übernehmen. Aktuell werden Bestandsaufnahmen für die Modernisierung der Anlage durchgeführt.
Bis heute ist die Füchtelner Mühle ein Charakteristikum der Kulturlandschaft an der Stever. Die denkmalgeschützten Gebäude erinnern an die ehemalige Funktion als voneinander getrennte Öl- und Kornmühle. Als Kulturgut ist die Doppelmühle von überregionaler Bedeutung. Zum Komplex gehören neben den Gebäuden die Wegeverbindungen, die alte Furt, der Mühldurchstich als Mühlstau und der ehemalige Hauptlauf des Flusses mit der dazwischenliegenden Insel. Die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach von Hochwasser schwerbeschädigte Mühle existiert heute seit über 700 Jahren an dieser Stelle.
Als die Stever ausgebaut wurde, kaufte die Gelsenwasser AG die Staurechte und die Mühlenanlage. Das Wasserversorgungsunternehmen wollte hier die Trinkwasserversorgung der benachbarten Stauseen sichern und koordinieren. 1992 erwarb Herr Ernst Herbst die Anlage und setzte sie mit viel persönlichem Engagement wieder instand. Der rechte Teil der ehemaligen Getreidemühle wurde zum Wohnhaus ausgebaut. 1996 wurde durch den Ingenieur Ernst Herbst in den linken Trakt der ehem. Ölmühle eine Wasserkraftanlage eingebaut, die bis heute in Betrieb ist.
Direkt an der Füchtelner Mühle liegt heute ein Flussstrand von dem aus die neue Steverumflut gut zu beobachten ist.
Dreibogenbrücke
Unweit der "Schiefen Brücke" befindet sich eine weitere Sehenswürdigkeit: Die historische Kanalbrücke über die Stever, die den Dortmund-Ems-Kanal über den Fluss leitete. Sie wurde 1894 errichtet und ähnelt in ihrer Bauweise sehr stark der Kanalüberführung an der Lippe (s.u.). Die Strecke führt dann weiter bis zum historischen Sperrtor in Olfen, mit dem das Ende der Alten Fahrt fast erreicht ist.
Erweiterung der Wasserstraße
Die Alte Fahrt ist das ursprüngliche Bett des Dortmund-Ems-Kanals. Nach zwanzig Jahren Betriebszeit musste diese Wasserstraße aufgrund des ständig wachsenden Schiffsverkehrs erweitert werden. Dazu wurde das Kanalbett an den Stellen, an denen es tiefer als das Erdniveau lag, ausgebaggert. Schwieriger war es dort, wo das Kanalbett weit über dem sonstigen Gelände lag. Um den Kanal nicht über Jahre schließen zu müssen, wurden hier "Neue" oder "Zweite" Fahrten mit größerem Querschnitt gebaut. Außerdem konnte dabei das Kanalbett begradigt werden. Von Datteln aus wurde 1929 bis 1937 eine neue Kanalstrecke Richtung Lüdinghausen gebaut.
Die Neue Fahrt wurde zunächst Ende der 1920er Jahre als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme durchgeführt und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten durch KZ-Häftlinge aus dem Börgermoor fertig gestellt.
Heute ein Fahrradweg
Heute führt durch das ehemalige Kanalbett der Alten Fahrt ein Fahrradweg und von der "Dreibogenbrücke" hat man einen grandiosen Blick über die Steveraue. Abends bietet die Brücke durch die Beleuchtung ein besonderes Highlight. Direkt unter der Brücke befindet sich ein weiterer Flussstrand.



Schiefe Brücke
"Die "Schiefe Brücke" von Olfen, berühmt wegen ihrer Einzelsteinmeißelung, wurde Ende des 19. Jahrhunderts, noch vor der Eröffnung des Dortmund-Ems-Kanals fertiggestellt. Sie gehört zu einem Ensemble von über 300 so genannten Kunstbauten - Schleusen, Brücken, Ein- und Durchlässe, Düker, das Lipper Pumpwerk -, die im Zusammenhang mit dem Bau des Schiffshebewerks Henrichenburg entstanden und immer ein bißchen in dessen Schatten gestanden haben.
Eine architektonische Besonderheit der "Schiefen Brücke" von Olfen sind die Stirnseiten (Ansichtsflächen). Für sie wurde, da sich der Kohlensandstein für die Gestaltung schwieriger Architekturformen weniger eignete, der rötliche Sandstein von Eichsfeld aus dem Arenhausener Bruch bei Kassel verwandt. Federführend beim Bau der Olfener Unterführung an der Oststraße war der Königlich-Preußische Oberbaudirektor K. Hinckeldeyn. Die Bauarbeiten dauerten von 1894 bis 1897, der Tag des "Gewölbeschlusses", des Richtfestes war der 1. September 1894.
Kanalbrücke Alte Fahrt - Lippe
Diese historische Kanalbrücke, mit deren Hilfe die sogenannte "Alte Fahrt" des Dortmund-Ems-Kanals die Lippe überquert wurde, befindet sich im Bereich Lehmhegge und kann nur zu Fuß über die alten Betriebswege des Kanals erreicht werden.
Um eine einheitliche Kanalhaltung zwischen Henrichenburg und Münster zu erreichen, wurde der Dortmund-Ems-Kanal in den Flusstälern von Lippe und Stever zwischen hohen seitlichen Dämmen geführt. 1895 wurde diese Kanalüberführung der Lippe fertig gestellt. Sie präsentiert sich in drei mächtigen Bögen aus Ruhrsandstein. Mit einer Spannweite von je 21 Metern wölbt sich die Brücke 18 Meter über dem Wasserspiegel der Lippe. Der Brückentrog ist 15 Meter breit und 70 Meter lang. Am Fuße der Kanalüberführung über die Lippe liegt das ehemalige Pumpwerk von 1897 zur Speisung des Dortmund-Ems-Kanals mit Lippewasser. Ein Bassin neben dem Fluss nahm das aus der Lippe fließende Wasser auf, das anschließend mit Hilfe von Dampfkraft in den Kanal gehoben wurde. Dazu wurden fünf Röhrendampfkessel von 200 Quadratmeter Heizfläche nebst Wasserreinigungsapparat sowie drei Dampfpumpen installiert. Mit Eröffnung des Datteln-Hamm-Kanals wurde im Juli 1914 das Pumpwerk an der Lippe außer Betrieb gesetzt und durch die Wasserübergabe in Hamm ersetzt. Das ehemalige Maschinenhaus befindet sich in Privatbesitzund ist nicht zugänglich. Ein Teil der Förderanlagen ist neben der Brücke noch erhalten.



Burgruine Rauschenburg
Überwuchert von Efeu und hohen Bäumen, beinahe mystisch anmutend: Die Ruine der Rauschenburg. Eine einstmals wichtige Grenzburg an strategisch wichtiger Stelle, wo schon die Römer vor 2000 Jahren die Lippe überquerten. Erstmal erwähnt wurde das Rittergut Rauschenburg 1050, gebaut an einer Furt an der zumeist unübergänglichen Lippe. Im Bereich der Burg bestand zeitweise die Möglichkeit, den Fluss mit Pferd und Wagen zu durchqueren. Ein Amtmann des Bischhofs Ludwig Landgraf von Hessen aus Münster wird 1317 als erster Besitzer genannt.
Abriss der Burg
Die Rauschenburg besaß ein dreigeschossiges Haupthaus mit Turm, umgeben von einer Gräfte. Eine Zugbrücke verband das Haupthaus mit dem Wirtschaftsgebäude und den Stallungen, die außerhalb des Wassergrabens lagen. Nach häufigen Besitzerwechseln ging die Rauschenburg 1823 zuletzt an die von Twickel zu Havixbeck. Um 1870 wurde die Burg lt. Überlieferung endgültig abgerissen. Es wird erzählt, dass die Anwohner mit Booten kamen, um die Steine abzuholen und sie auf ihren Höfen zu verbauen.
Die Rauschenburg heute
Heute findet man auf der kleinen, von der Gräfte umgebenen Insel nur noch einige Fragmente vom Mauerwerk. Alte, ehrwürdige Bäume halten den Standort mit ihren Wurzelwerk stabil. Die Ruine Rauschenburg ist in Privatbesitz und darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.
St. Vitus Kirche
Am 03.06.1877 war Baubeginn der heutigen Kirche als vierte Kirche Olfens. Erbaut nach den Plänen des Architekten Hilger Hertel mit lebendigen und bewegten Formen des gotischen Stils.
Pfarrer Dirking schreibt später: "Ursprünglich scheute man die großen Kosten eines neuen Hauptturmes. Lediglich ein kleiner Dachreiter (Kirchtürmchen) über der Vierung von Haupt- und Querschiff war vorgesehen. Aber die großartige neue gotische Kirche mit altem und niedrigem romanischen Turm wäre ein bedauernswerter Fehlgriff gewesen."
Maße der Kirche
Höhe 66,00 m
Länge 46,10 m
Breite 21,55 m
Kosten der Kirche
Bau 188.000 Mark
Inneneinrichtung 30.000 Mark
Spende von Pfarrer Dorrenden 80.000 Mark
Mehr Informationen unter www.stvitus-olfen.de.